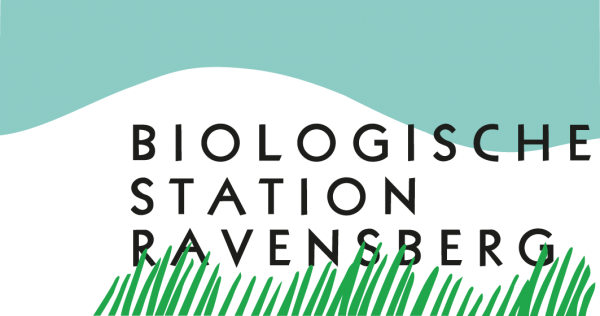„Das Grünland im Kreis Herford – eine Landnutzungsform mit bewegter Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft“
Verfaßt von Klaus Nottmeyer-Linden
Erschienen im Historische Jahrbuch 1997, Seite 127 – 137
Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 1996
Herausgegeben vom Kreisheimatverein Herford e.V.
ISBN 3-89534-180-0
Bezug über den Kreisheimatverein (Restposten) oder über die Biologische Station als pdf-Datei herunterladen.
Auszug aus der Veröffentlichung:
Einleitung:
Eine grüne Fläche ist nicht immer gleich Grünland. Entscheidend ist die Frage nach der Entstehung und der Nutzung – eine Frage mit historischer Tragweite. Nur ein kurzer Streifzug durch prähistorische und historische Zeiten der Landnutzung läßt letztendlich verstehen, was es mit dem Grünland auf sich hat. Die Entwicklung der Menschheit ist mit der des Grünlandes eng verbunden. Die Verwertung des Aufwuchses durch Vieh-haltung und Bewirtschaftung von Nahrungsflächen für das Vieh stellen die Grundlage für beide dar – bis heute.
Ursprüngliches Grünland findet sich nur dort, wo aus natürlichen Gründen keine Bäu-me und Sträucher wachsen – in den Savannen und Steppen. Außerhalb der Moore und einigen Teilen der Flußauen war Mitteleuropa – so ist der Stand der Forschung – vor der Besiedlung durch den Menschen ein geschlossenes Waldgebiet. Erst durch Rodung und Bewirtschaftung entstanden freie Flächen: Acker, Grünland (und bebaute Flächen). An diesem Punkt gehen allerdings heute die Meinungen der Wissenschaftler auseinander. Während ELLENBERG (1986) die Herkunft der Wiesenpflanzen mit Extremstandorten der Vorzeit zu erklären versucht, sehen andere in den früher in Mitteleuropa zahlreich weidenden Großtieren wie Auerochse, Steppennashorn, Altelefant und Mammut die Verursacher für die Entstehung natürlicher „Parklandschaften“ – mit genügend Lebensraum für die Wiesenpflanzen (MAY 1993, BUNZEL-DRÜKE et al. 1994). Ob nur auf Randstandorten oder auf Flächen mit „natürlicher Beweidung“ entstanden – nachdem die Menschen aus der Natur- eine Kulturlandschaft gemacht hatten, traten die Gräser und Kräuter ihren Siegeszug an.
Grob unterteilen kann man das eigentliche Grünland in Wiesen und Weiden – ausgehend von einer landwirtschaftlichen Nutzung durch Mahd bzw. Beweidung. Diese Unterscheidung ist besonders für die aktuelle Situation des Grünlandes bedeutsam. Für Wiese und Weide gilt gleichermaßen, daß sie überall dort verbreitet sind, wo der Ackerbau aus meist praktischen Erwägungen unterbleibt. Stets war Grünland die schlechtere Variante der Landnutzung; Grünlandflächen werden als minderwertig ein-gestuft. Allerorten wird Grünland sofort durch Acker ersetzt, wenn sich die Bedingunggen für den Ackerbau verbessern. Festzustellen ist aber nicht nur eine Konkurrenz zwischen Ackerbau und Viehzucht – wie man sie auch aus alten Westernfilmen kennt. Vielmehr haben sich Wiesennutzung und Ackerbau lange Zeit gegenseitig bedingt: ein altes Sprichwort sagt: „Die Wiese ist die Mutter des Ackerbaus“. Erst die Möglichkeit der Düngung mit Stallmist, dessen Grundlage letztendlich das Heu ist, erhöhte die Erträge im Ackerbau. Dieses relative Gleichgewicht zwischen den beiden Polen der Landwirtschaft kam erst dann aus dem Lot, als die technische Entwicklung den Ackerbau zum Nachteil der Grünlandflächen vorantrieb.
Tab.1: Vor- und Nachteile von Mahd und Beweidung
| Vorteile der Wiese | Nachteile der Wiese |
| Nutzung wo Ackerbau nicht möglich ist Heu gibt Mist („Wiese – die Mutter des Ackers“) Heu ist vielseitiger als Heu von Mähweiden | Arbeitsaufwand hoch Starke Wetterabhängigkeit Leistungssteigerung begrenzt Starke Besiedlung durch Wildkräuter Geringe Narbendichte |
| Vorteile der Weide | Nachteile der Weide |
| Beweidung erspart Bewirtschaftung geringe Wetterabhängigkeit Weidegang erhöht Narbendichte geringer Aufwuchs an Wildkräutern Schnelle Intensivierung möglich | Höhere Energieaufwand für die Tiere kein Mist, keine Gülle Geringe Ergiebigkeit im Winter |
Die Übersicht der Vor- und Nachteile (s. Tab. 1) führt zu der Annahme, die Weide sei wirtschaftlicher als die Wiese. Letztendlich hängt aber die Frage nach der Nutzung von klimatischen Faktoren ab. Das Ravensberger Hügelland liegt mitten im Übergangsbereich vom kontinentalen zum atlantischen Klima. In ganz Deutschland zeigt sich deshalb eine klimatisch verursachte Nord-Süd-Verteilung: Im Norden überwiegen die Weiden, im Süden die Wiesen. Eine Mischnutzung ist meist da verbreitet, wo eine ganzjährige Weidehaltung nicht möglich ist.
Die Zier- oder Gebrauchsrasen unserer Gärten sind im eigentlichen Sinne kein Grünland. Großflächige, nicht landwirtschaftliche genutzte Grünlandbereiche entstanden durch Nebennutzung, wie Straßenränder, Deiche und Flugplätze. Wesentliche Erscheinungsformen des wirtschaftlich genutzes Grünlandes sind:
- Mähweide: Eine Nachbeweidung folgt der Mahd;
- Dauerweide: Beweidung wenn möglich über das ganze Jahr;
- Streuwiese: weniger Schnitt, meist als Einstreu in den Ställen genutzt, kombiniert mit Obstanbau;
- Frischwiesen und weiden: Diese vorherrschende Grünlandform steht unter der Prämisse der landwirtschaftlichen Nutzung mit einer meist hohen Bewirtschaftungsintensität;
- Feuchtwiesen mit einer reichhaltigen Wasserversorgung, einer oft starken Überschwemmung und einer deshalb eingeschränkten Nutzung;
- Trockenrasen: der Sonne zugewandte Flächen, die oft nur wenig genutzt, meist auf kalkreichen oder sauren Böden und daher wenig ertragreich sind;
- Borstgrasrasen: wachsen auf mineralstoffarmen Böden und sind sehr artenreich.